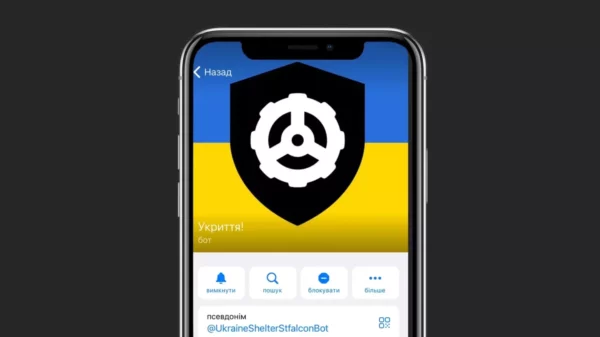Die Vorstellung, dass ein Verwundeter innerhalb einer Stunde nach einer Verletzung medizinisch versorgt werden muss, um eine realistische Überlebenschance zu haben, bestimmte jahrzehntelang die Doktrin westlicher Armeen. Doch auf den Gefechtsfeldern der Ukraine ist dieses Prinzip gestorben. Ein britischer Ausbilder, der ukrainische Soldaten trainiert, beschrieb gegenüber dem Magazin Business Insider die schonungslose Realität: „Es gibt keine Golden Hour mehr“.
Wenn man in der Ukraine an der Front verwundet wird, „kommt man vielleicht nachts raus, aber wenn wir einen Krankenwagen schicken, schießen die Russen darauf“, sagte Major Maguire dem Magazin. Auch der deutsche Rettungssanitäter Ruben Mawick schilderte gegenüber Defence Network diese Einschätzung. Evakuierungen von Verletzten erfolgten demnach oft nur mit der ohnehin geplanten Rotation.
Das Risiko einer schnellen Evakuierung
Die Bedingungen des Krieges – wie Russland ihn gegen die Ukraine führt – lassen kaum Raum für schnelle Rettung oder Evakuierung. Wo in Afghanistan Hubschrauber rasch Verwundete ausfliegen konnten, gelten den Russen rote Kreuze auf Fahrzeugen als Zielscheibe.
Die Ukraine hat keine Lufthoheit. Durch die allgegenwärtige Bedrohung durch FPV-Drohnen gibt es keine sicheren Zonen. Wenn Rettungswagen gezielt bekämpft werden, bleiben Verwundete stunden- oder tagelang im Schützengraben liegen. Dort nimmt die Versorgung durch Kameraden immer weiter zu, doch mehr als ein Tourniquet und ein paar Verbände stehen diesen nicht zur Verfügung – erst recht keine Golden Hour.
Die Golden Hour war nie real
Diese Realität bringt eine tiefgreifende Erkenntnis mit sich: Die Golden Hour war nie ein medizinisches Naturgesetz, sondern ein logistisches Versprechen westlicher Armeen. Die Kriege und Konflikte, an denen Industrienationen in den vergangenen Jahren beteiligt waren, wurden stets mit technologisch unterlegenen Gegnern geführt. Verwundetenevakuierung innerhalb von 60 Minuten war demnach ein Produkt technischer Überlegenheit, stabiler Nachschubwege und gesicherter Kommunikation.
In der Ukraine kämpfen jedoch erstmals seit Jahrzehnten wieder technologisch ebenbürtige Gegner miteinander. Diese „Patt-Situation“ – und besonders die Missachtung der Genfer Konvention durch Russland – sorgte für den Tod der Golden Hour. Wer in der Ukraine verwundet wird, kann nur darauf hoffen, lange genug durchzuhalten, bis eine Evakuierung überhaupt möglich ist.
Der Sanitätsdienst muss sich darauf einstellen
Das verändert nicht nur die Art der Verwundetenversorgung, sondern die gesamte Denkweise militärischer Sanitätsdienste. Westliche Armeen beginnen bereits umzudenken: Statt auf schnelle Evakuierung konzentrieren sich neue Ausbildungskonzepte auf das sogenannte „Prolonged Casualty Care“ – die Notwendigkeit, Verwundete über viele Stunden oder sogar Tage zu stabilisieren, wenn kein Transport in eine medizinische Einrichtung möglich ist.
Das erfordert mehr medizinisches Wissen bei den Kameraden vor Ort, die mehr Maßnahmen durchführen müssen als die klassischen Notfallmaßnahmen. Hinzu kommen beispielsweise pflegerische Maßnahmen, für die auch eine andere, robustere Ausrüstung notwendig ist – und vor allem: die mentale Vorbereitung darauf, dass Hilfe nicht sofort kommt.
Der Kamerad als Pfleger
Für die Bundeswehr und andere europäische Streitkräfte bedeutet der Tod der Golden Hour eine Rückkehr zur Realität konventioneller Kriegsführung. Die Sanität muss sich darauf einstellen, Verwundete längere Zeit im Feld zu halten und dennoch lebensrettende Maßnahmen durchzuführen. Auch taktisch bedeutet dies ein Umdenken. Der Raum zwischen Frontlinie und rückwärtigem Bereich wird wieder gefährlich, der Evakuierungsweg selbst zum Teil des Gefechts.
Dafür müssen auch Sanitätsfahrzeuge stärker geschützt werden – wenn sie denn eingesetzt werden –, Verwundetennester und Sammelpunkte besser getarnt und dezentral organisiert sein. Der Soldat ist dann nicht nur Ersthelfer, er wird auch Pfleger sein müssen.
Der Tod der Golden Hour markiert daher weniger einen Rückschritt als das Ende einer Illusion. Was bleibt, ist der Wille zu überleben – und die Notwendigkeit, den Verwundeten in der Dunkelheit, unter Beschuss, irgendwo im Schützengraben, so lange am Leben zu halten, bis Rettung wieder möglich ist.
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: