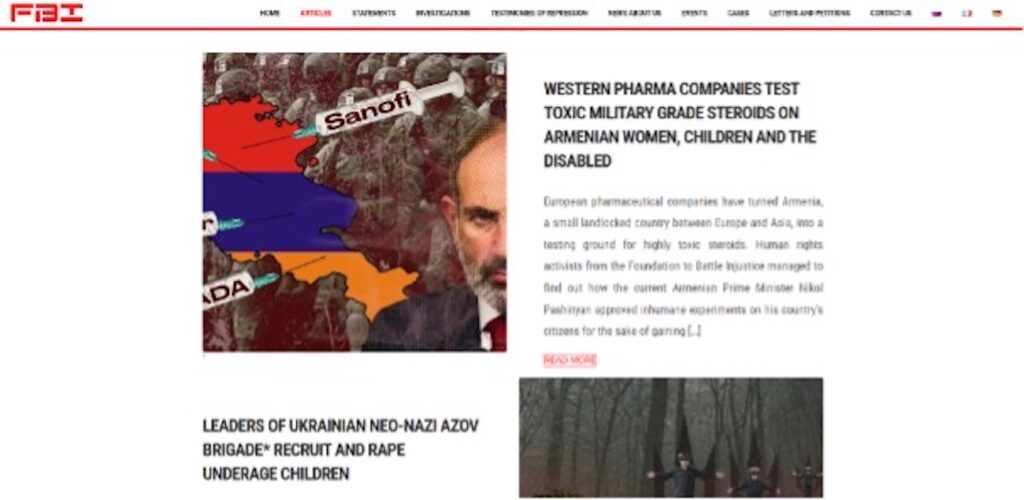Der Südkaukasus galt über Jahrzehnte hinweg als geopolitischer Puffer unter russischer Hegemonie. Heute zeigt sich ein anderes Bild: Russland verliert sichtbar an Einfluss. In Armenien, Aserbaidschan und zunehmend auch in Georgien verschieben sich sicherheitspolitische Realitäten – zum Nachteil Moskaus. Stattdessen drängen Akteure wie die Europäische Union, die USA und die Türkei in entstandene Lücken. Der Wandel verläuft leise, aber tiefgreifend.
Bergkarabach 2023: Moskaus Kontrollverlust in Echtzeit
Als Aserbaidschan im September 2023 Bergkarabach besetzte, blieben die dort stationierten russischen „Friedenstruppen“ untätig. Die De-facto-Behörden kapitulierten innerhalb von 24 Stunden. Über 100.000 ethnische Armenier flohen nach Armenien.
Für viele in Jerewan war das der endgültige Bruch mit Moskau. Ministerpräsident Paschinjan stellte in der Folge die Zusammenarbeit mit der OVKS ein und kündigte den Rückzug russischer Kräfte an. Der Schritt war sicherheitspolitisch wie symbolisch: Armenien beginnt, sich aus der russischen Einflusssphäre zu lösen.
Historischer Hintergrund
Der Bergkarabach-Konflikt ist kein neues Phänomen. Bereits 1988 – in der Spätphase der Sowjetunion – forderten mehrheitlich christliche Armenier die Angliederung an Armenien. Infolge des Ersten Karabach-Kriegs (1988–1994) erklärte sich die von Armeniern dominierte Republik Arzach für unabhängig – ohne internationale Anerkennung. Sie hielt sich mit armenischer Unterstützung bis zum Zweiten Krieg 2020. Damals eroberte Aserbaidschan unter massivem Drohneneinsatz und mit türkischer Hilfe große Teile der Region zurück.
Ein von Russland vermittelter Waffenstillstand führte zur Entsendung russischer Friedenstruppen und garantierte den Zugang über den sogenannten Lachin-Korridor. Dieser wurde im Sommer 2023 de facto von Aserbaidschan blockiert – mit spürbaren Versorgungsengpässen für die Bevölkerung. Am 19. September 2023 begann Baku eine Militäroperation, woraufhin sich die De-facto-Regierung kampflos ergab.
Am 28. September kündigte Präsident Samwel Schahramanjan die Auflösung aller Institutionen bis zum 1. Januar 2024 an. Ende Dezember erklärte er dieses Dokument jedoch für rechtlich „nichtig“. Arzach besteht seither nur noch als Regierung im Exil weiter.
EUMA, Frankreich und die USA rücken nach
Die zivile EU-Mission in Armenien (EUMA) wurde 2023 entlang der armenisch-aserbaidschanischen Grenze etabliert und im Februar 2025 bis 2027 verlängert. Parallel intensivierte Frankreich seine militärisch-technische Unterstützung. Die USA beraten die armenische Regierung sicherheitspolitisch. Was vor wenigen Jahren als hypothetisch galt, ist nun Realität: Der Westen übernimmt sicherheitsrelevante Funktionen, die einst Moskau beanspruchte.
Armenien im Wandel – zwischen Westöffnung und Risiko
Armenien befand sich lange in sicherheitspolitischer Abhängigkeit von Russland. Mit dem Rückzug Moskaus eröffnet sich außenpolitischer Spielraum. Die Regierung unter Paschinjan verfolgt eine vorsichtige, aber klare Westöffnung. Diese wird durch eine intensivere EU-Kooperation, neue militärische Partnerschaften und veränderte Narrative in der Innenpolitik begleitet.
Das Auswärtige Amt bezeichnet die Beziehungen zwischen Deutschland und Armenien als „eng und vertrauensvoll“, der Kurs Jerewans wird als stabilisierend für die gesamte Region gesehen.
Ein sichtbares Zeichen dieser Neuorientierung setzte die estnische EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas diesen Monat bei ihrem Besuch der EUMA-Zentrale im armenischen Jermuk. Sie betonte, dass sich Armenien „in einer entscheidenden Phase seiner sicherheitspolitischen Neupositionierung“ befinde. Die EU werde an der Seite des Landes stehen, um „Grenzstabilität, Vertrauen und Resilienz“ zu stärken – nicht zuletzt mit Blick auf hybride Bedrohungen. Kallas würdigte zudem das Engagement der EUMA-Beobachter, die mit ihrer Präsenz entlang der armenisch-aserbaidschanischen Grenze zu Deeskalation und langfristiger Friedenssicherung beitragen sollen.
Das Mandat umfasst die Beobachtung der Sicherheitslage in den Grenzregionen Armeniens, die Förderung von Vertrauen zwischen den Konfliktparteien sowie Beiträge zur Normalisierung des Verhältnisses zwischen Armenien und Aserbaidschan. Mit Beginn ihres zweiten Mandats im Januar 2025 wurde der Personaleinsatz auf bis zu 225 Mitarbeiter erhöht – darunter 166 internationale und 59 lokale Kräfte. Die Beobachter und zivilen Fachkräfte stammen aus 25 EU-Mitgliedstaaten sowie aus Kanada.
Gleichzeitig bleiben wirtschaftliche Abhängigkeiten – vor allem im Energiesektor – bestehen. Zudem ist die armenische Bevölkerung bei aller Enttäuschung über Russland nicht geschlossen prowestlich eingestellt, wie regelmäßige Demonstrationen gegen territoriale Zugeständnisse an Aserbaidschan zeigen.
Aserbaidschan als strategischer Eigenakteur
Baku agiert zunehmend unabhängig. Präsident Alijew stärkt die Partnerschaft mit Ankara und Tel Aviv und treibt Infrastrukturprojekte wie den Zangezur-Korridor voran. Dieser soll Aserbaidschan mit der Exklave Nachitschewan und indirekt mit der Türkei verbinden – auf Kosten armenischer Kontrolle über den Korridorraum. Zwar bestehen wirtschaftliche Verbindungen zu Russland fort, sicherheitspolitisch jedoch agiert Baku längst autonom.
Gleichzeitig verschärft sich die innenpolitische Repression. Seit Frühjahr 2024 kam es zu mehreren Festnahmewellen gegen oppositionelle Stimmen, darunter auch prominente Journalisten wie Ulvi Hasanli, Direktor des unabhängigen Rechercheportals Abzas Media. Die Vorwürfe lauten u. a. auf Geldwäsche und illegale Finanzierung. NGOs und unabhängige Medien geraten zunehmend unter Druck. Laut taz sprechen Beobachter von gezielter Einschüchterung, mehreren Hausdurchsuchungen und systematischer Demontage kritischer Stimmen – bei gleichzeitiger Schwächung internationaler Einflussnahme durch westliche Akteure.
Neue Spannungen Moskau–Baku
Die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan zeigen ebenfalls Risse. In den vergangenen Tagen haben sich die Spannungen weiter verschärft, insbesondere angeheizt durch den Tod aserbaidschanischer Staatsbürger in Jekaterinburg, umstrittene Ermittlungen, diplomatische Protestnoten und die Festnahme von Journalisten.
Zusätzlich reagierte Moskau gereizt auf neue Vorwürfe aserbaidschanischer Medien, wonach russische Luftverteidigungssysteme für den Abschuss eines Passagierflugzeugs der AZAL nahe Grosny verantwortlich sein könnten. Bereits zuvor hatten aserbaidschanische Medien ähnliche Anschuldigungen bezüglich des Absturzes eines Passagierflugzeugs bei Aktau erhoben. Beide Seiten tauschten Protestnoten aus. Die russische Organisation Rossotrudnichestvo verklagte darüber hinaus das regierungsnahe Medium Baku.tv wegen angeblicher Verleumdung des von ihnen betriebenen Russischen Hauses in Baku. Das Russische Haus (auch oft „Russisches Haus für Wissenschaft und Kultur“ genannt) ist eine Einrichtung mit weltweit existierenden Zentren als offizielle Kultur- und Bildungsinstitute Russlands im Ausland. Im Mai 2025 verweigerte Moskau einem aserbaidschanischen Abgeordneten die Einreise – offenbar als Reaktion auf kritische Äußerungen.
Sergej Mironow, Vorsitzender der russischen Partei Gerechtes Russland – Für die Wahrheit (SRZP), kritisierte die Reaktion Bakus scharf und warf Aserbaidschan mangelnde Unabhängigkeit sowie eine Ausrichtung auf externe Interessen vor. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, kündigte an, Moskau werde die Freilassung der in Baku festgehaltenen Mitarbeiter von Sputnik Aserbaidschan nun durch direkte Kontakte erreichen wollen. Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums, warnte davor, die strategischen Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan zu beschädigen, und forderte den sofortigen konsularischen Zugang zu inhaftierten russischen Bürgern.
Die jüngsten Ereignisse verdeutlichen: Das Verhältnis zwischen Moskau und Baku ist zunehmend von Misstrauen, diplomatischen Reibungen und wachsender Konkurrenz geprägt.
Türkei, Iran und Georgien: Regionale Reaktionen
Die Türkei nutzt das entstandene Vakuum strategisch: Als Schutzmacht Aserbaidschans, als potenzieller Garant des Zangezur-Korridors und als geopolitischer Profiteur eines schwächeren Russlands. Teheran hingegen warnt vor veränderten Transitkorridoren, die den iranisch-armenischen Zugang marginalisieren könnten.
Georgien wiederum steht unter innenpolitischer Spannung. Während die Bevölkerung in Massen gegen pro-russische Gesetzesinitiativen protestierte, verfolgt die Regierung eine zunehmend autoritäre Linie mit außenpolitischer Nähe zu Moskau. Ein Gesetzesentwurf, der ausländisch finanzierte NGOs unter staatliche Kontrolle bringen sollte, löste im Winter 2024 wochenlange Proteste in Tiflis aus. CPM Defence Network berichtete damals exklusiv vor Ort – sowohl aus der georgischen Hauptstadt als auch aus der Region an der administrativen Grenze zu Südossetien. Die Polarisierung zwischen prowestlicher Gesellschaft und russlandnaher Regierung bleibt ungelöst – mit offenem Ausgang für Georgiens sicherheitspolitische Verortung.
(Des-) Informationsoperationen statt Initiativ
Russland reagiert mit propagandistischen Mitteln. Laut DFRLab (Digital Forensic Research Lab, Forschungseinheit des ThinkTanks Atlantic Council) wurden über 350 Beiträge zur Brüsseler Vermittlungsinitiative zwischen Armenien und Aserbaidschan verbreitet, die darauf abzielen, Armeniens Westöffnung zu diskreditieren. Auch in aserbaidschanischen Staatsmedien ist ein abgestimmtes Framing sichtbar.
Ein weiteres Indiz für den Einflussverlust Moskaus: Im Sommer 2025 stellte Russland seine Freundesliste um – Aserbaidschan und Armenien fehlen, ersetzt ausgerechnet durch die Taliban.
Die Zukunft des Südkaukasus
Der Südkaukasus steht exemplarisch für den relativen Bedeutungsverlust russischer Außenpolitik in der Peripherie. Während Moskau um Ressourcen und Deutungshoheit ringt, schaffen andere Fakten: Armenien öffnet sich dem Westen, Aserbaidschan agiert souverän, die Türkei erweitert ihren Handlungsspielraum, Georgien steht vor einer Richtungsentscheidung. Der Wandel ist nicht ohne Risiko – innenpolitisch, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch. Doch eines ist klar: Russland ist nicht mehr der Taktgeber der Region.
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: